Wenn im Winter der Schnee meterhoch auf den Bergen von Honshu liegt und selbst die Flüsse gefrieren, zieht sich das Leben in Japan zurück. Nur eine Art bleibt sichtbar – die Makaken. Sie sitzen dampfend in heißen Quellen, das Fell feucht, die Gesichter rot vor Wärme, und blicken in den aufsteigenden Dampf, als betrachteten sie darin die Welt. Es sind Szenen, die jeder kennt, doch kaum jemand begreift, was sie wirklich zeigen: das uralte Band zwischen Tier, Natur und Mensch in Japan.

Alle Berichte in
„Wildes Japans: Japans wundervolle Natur erleben„
>> bei Amazon
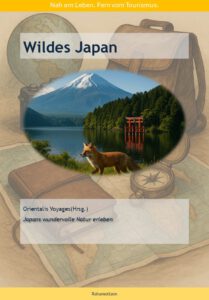
Die Japanmakaken, auch Schneeaffen genannt, sind die nördlichsten Primaten der Erde. Sie leben dort, wo kein anderer Affe überlebt – in eisigen Wäldern, auf steilen Bergen, an heißen Quellen. Und sie tun dies nicht, indem sie die Natur bezwingen, sondern indem sie sich ihr anpassen.
Landschaften des Lebens
Wer einmal im Winter durch die Berge von Honshu gereist ist, versteht, warum die Makaken hier geblieben sind. Das Land ist hart, aber ehrlich. Die Luft riecht nach Schnee und Holzrauch, und die Stille hat ein Gewicht, das man im Körper spürt. Zwischen den grauen Stämmen der Zedern und den schwarzen Felsen liegt eine Welt, die wie angehalten wirkt – als hielte selbst die Zeit den Atem an, bis der Frühling wiederkehrt.
In dieser weißen, dampfenden Einsamkeit leben die Makaken. Sie suchen sich Plätze, an denen der Boden noch warm ist, wo heiße Quellen aus der Erde treten und Dampf in dichten Schwaden über das Tal zieht. Am bekanntesten ist das Tal von Jigokudani, das „Höllental“, in dem die Erde zischt und grollt, als wolle sie ihre Lebendigkeit nicht verbergen. Doch für die Makaken ist es kein Ort des Schreckens, sondern ein Zuhause. Sie sitzen dort im Dampf, eng beieinander, das Fell glitzernd vom Wasser, die Gesichter rot wie Winteräpfel.
Wenn man sie beobachtet, spürt man schnell, dass sie nicht einfach überleben – sie leben. Sie balgen sich, sie betrachten den Himmel, sie nehmen einander in den Arm. Ihr Verhalten ist ruhig, manchmal fast andächtig. Sie wirken, als wüssten sie, dass der Winter kein Feind ist, sondern ein Teil des Kreises, dem sie angehören.
Abseits der heißen Quellen durchstreifen sie die verschneiten Wälder. Ihre Hände graben im Boden nach Wurzeln und Samen, sie knabbern an Rinde, teilen die Beute miteinander. Junge Tiere tollen durch den Schnee, springen sich an, rutschen über gefrorene Hänge. Manchmal hört man ihr Rufen zwischen den Bäumen – kurz, rau, aber vertraut, wie ein Gespräch unter Freunden.
Die Landschaft, die sie bewohnen, ist nicht leicht zu lieben, aber sie hat Charakter. Steile Hänge, tiefe Täler, Flüsse, die sich durch Fels schneiden. Und doch liegt in dieser Strenge eine eigenartige Wärme. Vielleicht, weil alles, was hier lebt, gelernt hat, mit Maß zu existieren. Die Makaken haben keinen Besitz, keine Pläne, keine Angst vor Stillstand. Sie folgen dem, was der Tag ihnen gibt – Sonne, Schnee, Wärme, Hunger, Nähe.
Wer ihnen begegnet, erkennt etwas, das man selten spürt: das Gleichgewicht zwischen Trotz und Gelassenheit. Diese Tiere sind Kinder einer Landschaft, die nichts verzeiht, aber alles lehrt. Und vielleicht ist das der Grund, warum sie uns so vertraut vorkommen – weil in ihrer Ruhe ein Stück von dem liegt, was wir selbst suchen: ein Platz inmitten der Kälte, an dem man einfach sein darf.
Zwischen Mensch und Wildnis
In den Bergen Japans gehört der Affe zum Alltag. Man trifft ihn nicht im Zoo, sondern auf dem Weg zum Schrein, im Obstgarten, auf den Dächern alter Bauernhäuser. Die Menschen dort sprechen über ihn, als wäre er ein Nachbar – ein lästiger, aber auch liebgewonnener. „Er stiehlt unsere Pfirsiche“, sagt ein Bauer und lacht dabei, „aber wenigstens isst er sie mit Genuss.“
In den Dörfern herrscht ein stilles Einvernehmen. Die Makaken kommen aus dem Wald, holen sich, was sie brauchen, und verschwinden wieder. Manchmal hängen sie in den Stromleitungen, manchmal sitzen sie auf Friedhofsmauern und betrachten die Welt. Die Bauern wissen, dass es sinnlos ist, sie zu vertreiben. Also pflanzen sie ein paar Bäume am Waldrand, damit die Affen dort bleiben. Ein alter Tauschhandel, unausgesprochen, aber wirksam: Ihr lasst uns leben, wir lassen euch leben.
Anders ist es in den Städten. In Orten wie Nagano oder Nikko, wo der Wald nah an die Straßen heranrückt, geraten Mensch und Tier enger aneinander. Manchmal steht morgens ein Makake auf einem Parkplatz, als würde er über das Blechmeer staunen. In den Vororten Tokios wurden sie gelegentlich gesehen – fremd, neugierig, irritiert vom Lärm. Dort, wo Neonlicht auf Beton trifft, verlieren sie ihre Selbstverständlichkeit. Sie gehören in die Berge, in die Dörfer, in die Kälte – nicht zwischen Automaten und Reklametafeln. Und doch kommen sie. Weil die Städte wachsen, weil das Land stiller wird.
Das Verhältnis zwischen Mensch und Affe ist so alt wie vertraut. Im Shintō-Glauben gilt der Makake als Begleiter der Berggötter, als Mittler zwischen Himmel und Erde. Er steht für Lebenskraft, Neugier und Schutz. In alten Schreinen sieht man hölzerne Tafeln mit seiner Gestalt – lachend, wachsam, weise. Doch aus der Religion ist eine Nachbarschaft geworden. Der Respekt blieb, aber die Distanz schrumpfte.
In den Tälern von Honshu sprechen die Menschen nicht über „Natur“, sie leben in ihr. Hier weiß man, dass jedes Wesen seinen Platz hat, solange es den der anderen achtet. Die Städter dagegen betrachten den Affen durch Kameras, durch Fensterscheiben, durch Regeln. Für sie ist er ein Exot – niedlich, gefährlich, fremd. Für die Dorfbewohner ist er einfach da. Ein Wesen wie der Regen oder der Wind: manchmal lästig, manchmal schön, immer unvermeidlich.
Es gibt auch Zärtlichkeit in dieser Beziehung. Kinder in Bergdörfern imitieren die Makaken, machen ihre Rufe nach, lachen über ihre Sprünge. Alte Männer erzählen Geschichten von Jahren, in denen der Schnee so hoch lag, dass Menschen und Affen sich dieselben Quellen teilten. Manche sagen, es gäbe Familien, die den gleichen Clan von Makaken seit Generationen kennen – Tiere, die denselben Pfad hinuntersteigen, dieselben Äste nutzen, dieselben Gesichter tragen wie vor fünfzig Jahren.
Die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation verläuft hier nicht auf der Landkarte, sondern in den Köpfen. Und sie ist fließend. Vielleicht, weil beide – Mensch und Makake – etwas gemeinsam haben: den Drang, Nähe zu suchen, ohne sich zu verlieren.
Am Ende des Tages, wenn der Nebel vom Tal aufsteigt und das Licht weich wird, sieht man manchmal eine Gruppe Affen am Waldrand. Sie sitzen still, fast ehrfürchtig, als lauschten sie dem Rauschen der Welt. Unten im Dorf glühen die Fenster der Häuser, oben im Wald schneit es leise. Zwei Lebensräume, so nah beieinander, dass sie sich gegenseitig spiegeln. Und man begreift, dass Japan nicht dort geteilt ist, wo Beton auf Moos trifft, sondern dort, wo man verlernt, in den Augen eines Tieres sich selbst zu erkennen.
Gefährten im Wald – Die Zika-Hirsche
Wenn man in den feuchten Wäldern Yakushimas oder in den Bergregionen Zentral-Honshus wandert, kann man manchmal eine merkwürdige Szene beobachten: Ein Affe sitzt auf dem Rücken eines Hirsches. Kein Zufall, kein Scherz der Natur – sondern eine leise, uralte Übereinkunft zwischen zwei sehr unterschiedlichen Geschöpfen.
Die Japanmakaken und die Sika-Hirsche teilen sich denselben Lebensraum, und über Generationen hinweg haben sie gelernt, miteinander statt gegeneinander zu leben. Es ist keine Freundschaft im menschlichen Sinn, aber es ist Nähe, Respekt – und ein System, das funktioniert. Die Makaken sind die neugierigen Beobachter, flink, wendig, intelligent. Die Hirsche dagegen sind geduldig, kräftig, standfest. Beide ergänzen sich wie zwei Seiten derselben Münze.
Wenn die Affen in den Baumwipfeln Früchte pflücken, lassen sie oft Reste fallen. Kaum liegen die Stücke auf dem Waldboden, kommen die Hirsche und fressen sie. Die Makaken profitieren davon, dass die Hirsche sie begleiten – sie warnen vor Feinden, räumen Wege frei, und wo die Hirsche durchziehen, finden die Affen leichter Nahrung, weil der Boden offen liegt. Im Gegenzug suchen die Makaken nach Parasiten im Fell der Hirsche. Sie sitzen auf deren Rücken, zupfen, kämmen, rupfen. Für die Hirsche ist das eine Wohltat – eine Massage und Reinigung zugleich. Manche Hirsche scheinen die Gesellschaft sogar zu suchen: Sie bleiben ruhig stehen, senken den Kopf, als wüssten sie, dass gleich eine helfende Hand kommt.
In dieser Gemeinschaft sind die Hirsche die stillen Träger, die Makaken die Regisseure. Die Dominanz wechselt, je nach Situation. Auf dem Boden führt der Hirsch, hoch in den Ästen der Wald. Wenn Nahrung knapp wird, entscheiden die Affen, wohin die Gruppe zieht – doch wenn Gefahr droht, verlässt man sich auf das Gehör der Hirsche. Es ist ein Miteinander, das auf Erfahrung beruht, nicht auf Instinkt allein.
Forscher haben beobachtet, dass Makaken ihre vertrauten Hirsche erkennen und bevorzugen. Manche klettern immer wieder auf dieselben Tiere, wie alte Freunde. Auch das umgekehrte Verhalten kommt vor: Hirsche folgen Makaken, wenn diese in neue Gebiete wandern, weil sie wissen, dass dort Nahrung zu finden ist. So entsteht ein stilles Netzwerk, das sich ohne Worte erhält – ein Austausch von Nutzen, aber auch von Vertrauen.
Diese Symbiose hat praktische Vorteile für beide: Die Hirsche werden von Parasiten befreit, die Affen erhalten Nahrung und Schutz. Doch dahinter steckt mehr – eine Lektion über Maß und Balance. In einer Welt, die oft auf Wettbewerb beruht, zeigen diese Tiere, dass Zusammenleben eine Frage von Rhythmus und Rücksicht ist. Niemand führt, niemand folgt; beide finden ihr Gleichgewicht, indem sie das des anderen achten.
Vielleicht ist genau das der Grund, warum diese Szenen so berühren. Wenn man sie sieht – den Affen, der auf dem Rücken eines Hirsches sitzt, beide still im Nebel des Morgens – dann wirkt das nicht wie ein Zufall der Evolution, sondern wie eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, dass das Leben nicht immer Kampf sein muss, sondern manchmal einfach ein stilles Einverständnis.
In Japan, wo selbst Steine und Flüsse als beseelt gelten, wundert das niemanden. Denn hier, in den tiefen Wäldern, sind die Grenzen zwischen den Wesen fließend. Alles lebt vom anderen, und alles lässt das andere leben.
Und vielleicht ist es genau das, was diese beiden Tiere so japanisch macht: Sie haben begriffen, dass Stärke nicht im Beherrschen liegt, sondern im Teilen.
Kinder des Dampfes, Wächter der Kälte
Wenn der Winter in die Berge von Honshu zieht, verwandelt sich die Landschaft in ein Meer aus Weiß. Schnee türmt sich auf den Dächern der Hütten, Äste brechen unter der Last, Flüsse erstarren zu glänzenden Adern aus Eis. Die Welt wird still. Nur der Wind bleibt – ein langes, tiefes Atmen, das über die Täler streicht.
Und doch ist dieser Winter nicht leer. Er gehört den Makaken. Sie sind geblieben, während viele andere Tiere in tiefere Lagen gezogen sind. In kleinen Gruppen bewegen sie sich durch die verschneiten Wälder, die Rücken rund, die Gesichter offen dem Schnee entgegen. Ihre Fußspuren zeichnen ein Netz über die weiße Fläche, das an die Wege alter Pilger erinnert – verschlungen, zielstrebig, voller Geduld.
In dieser Jahreszeit sind sie aufeinander angewiesen wie nie. Sie wärmen sich gegenseitig, teilen Nahrung, schützen die Jungtiere im Fell der Mütter. Wenn der Sturm aufzieht, rücken sie zusammen, eng wie Steine in einer Mauer. Ihre Nähe ist nicht nur Zuneigung, sie ist Überleben. Am Abend sitzen sie auf Felsen, an denen die Erde noch warm ist, und lassen den Dampf an ihren Körpern aufsteigen. Dann sehen sie aus wie Wesen aus einer anderen Zeit – als hätte der Nebel selbst Gestalt angenommen.
Im Jigokudani-Tal, wo heiße Quellen aus dem Fels brechen, haben die Makaken gelernt, das Feuer der Erde zu nutzen. Sie steigen in die Becken, lassen sich treiben, die Augen halb geschlossen, das Fell feucht und dampfend. Manchmal hockt eine ganze Familie im Wasser, dicht beieinander, während Schneeflocken lautlos auf ihre Köpfe fallen. Es ist ein Bild, das man kaum vergisst: Diese Tiere, geboren in der Kälte, suchen keine Flucht, sondern Balance. Sie nehmen, was die Erde ihnen gibt – Wärme aus dem Feuer, Nahrung aus dem Frost.
Die Alten sagen, dass die Affen den Menschen das Baden gelehrt hätten. Und wer sie so sieht, versteht, warum man das glaubt. Ihre Bewegungen sind ruhig, fast andächtig. Kein hektisches Spritzen, kein wildes Spiel – nur das stille, tiefe Genießen von Wärme. Wenn man ihnen ins Gesicht schaut, entdeckt man einen Ausdruck, der uns vertraut vorkommt: Nachdenklichkeit, vielleicht sogar Dankbarkeit.
Doch der Winter prüft sie hart. Nahrung ist knapp, das Land gnadenlos. Sie müssen graben, um Wurzeln zu finden, und den Schnee mit ihren Händen aufbrechen. Ihre Lippen sind rissig, die Finger rau. Und dennoch behalten sie Würde. Kein Tier hier klagt, keines hadert. Es ist, als hätten sie begriffen, dass die Kälte kein Feind ist, sondern Teil eines Gleichgewichts.
Diese Affen sind Kinder des Dampfes – geboren in der Wärme der Erde – und Wächter der Kälte zugleich, die sie zu dem macht, was sie sind. In ihnen lebt eine Ruhe, die man nur in Landschaften findet, die nichts versprechen außer Ehrlichkeit. Wenn sie durch den Schnee gehen, tun sie es nicht hastig, sondern bedacht, als wüssten sie, dass jeder Schritt kostbar ist.
Manchmal sitzt man am Rand eines dieser heißen Becken, der Atem gefriert, die Kamera vergessen, und sieht einfach nur zu. Ein junges Tier taucht vorsichtig ins Wasser, seine Mutter zieht es zu sich. Ein alter Makake blickt in den Dampf, als lausche er auf etwas, das nur er hören kann – den Puls der Erde vielleicht, oder das Echo eines Winters, den schon Generationen vor ihm überstanden haben.
Und man begreift, warum die Japaner ihnen in Mythen und Geschichten immer wieder eine fast menschliche Seele zusprechen. Weil sie, ohne Sprache, etwas ausdrücken, was wir mit Worten kaum fassen: das Einverständnis mit dem Leben selbst – so wie es ist, mit allem, was es schenkt und nimmt.
Wenn der Morgen graut und der Dampf sich auflöst, steigen sie wieder hinaus in den Schnee. Ihre Körper dampfen, der Atem hängt in der Luft, die Sonne blitzt zwischen den Bergen. Ein neuer Tag beginnt, und sie gehen weiter, ruhig, geschlossen, unbeirrt. Sie wissen, dass jeder Winter vergeht – und dass das, was bleibt, nicht die Kälte ist, sondern das Miteinander.
Fazit – Spiegel der Seele
Wenn man den Makaken im Dampf der heißen Quellen zusieht, versteht man etwas über das Leben, das keine Worte braucht. Da sitzen sie, die Gesichter rot von der Wärme, während Schnee auf ihr nasses Fell fällt, und alles scheint stillzustehen. Doch in dieser Ruhe liegt Bewegung, in dieser Einfachheit eine ganze Welt. Sie leben, ohne zu kämpfen, sie nehmen, was der Tag bringt, und fügen sich in den Rhythmus der Erde, als gehörten sie schon immer zu ihr.
Die Makaken lehren, dass Überleben nicht Widerstand bedeutet, sondern Beziehung – zu den anderen, zur Kälte, zum Atem der Berge. Der Mensch baut Mauern gegen das Wetter, die Tiere finden darin ihren Platz. Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Weisheit: nicht immer stärker zu werden, sondern einfühlsamer.
Wer ihnen begegnet, spürt, dass diese Tiere mehr sind als Teil der japanischen Wildnis. Sie sind Spiegel und Erinnerung zugleich – Spiegel einer Gelassenheit, die wir verloren haben, und Erinnerung daran, dass Wärme nicht aus Feuer entsteht, sondern aus Nähe. In ihrem Schweigen liegt etwas Tröstliches, ein Wissen darum, dass Leben auch in der Kälte bestehen kann, wenn man nicht allein steht.
Am Ende geht man fort und hat das Gefühl, etwas sehr Altes verstanden zu haben, etwas, das man schon immer wusste und nur vergessen hatte. Dass selbst im Frost noch Wärme wohnt. Und dass Wildnis, richtig betrachtet, nichts Feindliches ist – sondern die ehrliche Form des Lebens selbst.


Comments are closed